Vom Mit-Arbeiter zum Mit-Unternehmer
Wie muss Industrie künftig beschaffen sein, um zu bestehen? Könnte sich die Trennung zwischen dem Produzenten und seinem Kunden auflösen? Und was passiert dann mit unserer Wertschöpfungskette? Ein Gedankenspiel von Prof. Dr. Andreas Syska über gesamtgesellschaftliche Entwicklungen hin zu einem digitalen Morgen.

Was passiert, wenn Wertschöpfung nicht länger zentralisiert, sondern in flexiblen Netzwerken stattfindet? Durch einen Kunden, der selbst produziert, und Mitarbeiter, die an Produktivitätsgewinnen teilhaben, entstehen neue Industrie- und Gesellschaftsmodelle. Prof. Dr. Andreas Syska wagt für uns in diesem Gastbeitrag ein Gedankenspiel, wie wir künftig wirtschaften und arbeiten werden.
Für die Industrie, wie wir sie kennen, hat das letzte Kapitel begonnen – sie weiß es nur noch nicht. Produzenten glauben gerne daran, dass sie so etwas wie das Hoheitsrecht auf Wertschöpfung besitzen und perfektionieren Fabriken, die es so in zwanzig Jahren vielleicht gar nicht mehr geben wird.
Tatsächlich wird die Wertschöpfung in Zukunft dezentralisiert sein und im Handel stattfinden sowie im Handwerk und in Privathaushalten. Oder in Makerspaces: Sie ermöglichen jedem den Zugriff auf smarte Betriebsmittel, wie Cobots oder 3D-Drucker. Das ist zwar häufig noch in den technischen Anfängen, aber die Fortschritte sind gewaltig. Wenn diese Orte der Wertschöpfung einmal vernetzt sind, dann wird sich Produktion dorthin verlagern. In absehbarer Zukunft wird sich ein erheblicher Teil der Wertschöpfung in flexiblen Netzwerken abspielen. Mit anderen Worten: Viele Wertströme umfahren die Fabriken.
Der Kunde fertigt seine Güter selbst
Die klassische Produktion steht vor einem weiteren grundlegenden Wandel: die derzeit bestehende Trennung zwischen dem Produzenten und seinem Kunden löst sich auf. Der Produzent von morgen entwickelt und fertigt keine Güter mehr, sondern befähigt andere, dies zu tun. Verstanden haben dies die Wenigsten.
Was wie Zukunftsmusik klingt hat schon begonnen – und mittendrin die Cobots.

Produktivitätsgewinne anders teilen
Der Roboter wurde klein und smart und konnte deshalb aus der Käfighaltung befreit werden. Er steht nun in der Nähe des Mitarbeiters und reicht ihm höchst kollaborativ das Werkstück an. Deshalb nennt er sich ja auch Cobot. Damit ist er aber noch lange nicht der Freund des Mitarbeiters. Im Gegenteil: Der Mitarbeiter hört die Botschaft des Cobots allzu deutlich: „Eigentlich würde ich gerne Deinen gesamten Job übernehmen, bin dafür aber noch zu teuer.“. Mit Betonung auf: „Noch!“. Über dem Mitarbeiter hängt weiterhin das Damoklesschwert der Ersetzbarkeit. Und das weiß er nur zu gut.
Dies würde sich erst dann ändern, wenn die Unternehmer sich nicht länger weigern, die Früchte des Produktivitätsgewinns – z.B. durch Cobot-Einsatz – mit ihren Mitarbeitern zu teilen.
Ideen für Beteiligung an Produktivitätsrendite
Mitarbeiter am Produktivitätsgewinn materiell teilhaben lassen? Warum sollten Unternehmer dies tun? Ganz einfach: Weil sie keine andere Wahl haben. Sie brauchen Kaufkraft. Niemandem ist geholfen, wenn die Fabriken menschenleer sind und sich keiner mehr die autonom hergestellten Produkte leisten kann. Und bevor jetzt der Begriff „Wachstumsmarkt“ fällt: Eben dieser wird ja durch die Kürzung der Lohnsumme ausgetrocknet.
Der Cobot wird nach Feierabend nicht shoppen gehen – und nicht nur, weil er keinen Feierabend kennt. Deshalb gilt: Wenn wir Bedarfsgüter hochautomatisiert produzieren, dann muss der Mitarbeiter, der nur noch einen Bruchteil der Zeit arbeitet, trotzdem voll bezahlt werden. Den Produktivitätsgewinn müssen sich Unternehmer und Mitarbeiter in Zukunft fair teilen. Er darf nicht wie bisher nur der Kapitalseite gutgeschrieben werden – in ihrem eigenen Interesse.
Eine Lohnerhöhung wäre aber fantasielos und die Aufforderung, Aktien zu kaufen, zynisch. Zum einen arbeiten die wenigsten Menschen in börsennotierten Unternehmen, zum anderen hängt deren Aktienkurs von allen möglichen Dingen ab, am wenigsten aber von der Leistung der dort Beschäftigten.
Auch ist die Besteuerung von unternehmerischer Initiative durch eine Robotersteuer ebenso wenig eine Lösung wie das Ausbezahlen einer Stilllegungsprämie an die Digitalisierungsverlierer, genannt Bedingungsloses Grundeinkommen.

Spielregeln ändern, Mitarbeiter beteiligen
Gehen wir also einen beherzten Schritt nach vorn, ändern die Spielregeln und machen aus dem Mit-Arbeiter den Mit-Unternehmer. Plakativ gesprochen: Würde der Cobot dem Mitarbeiter (mit-)gehören, dann wäre der vom Cobot erzielte Produktivitätsgewinn nicht mehr eine Gefahr für die materielle Existenz des Mitarbeiters, sondern ein Beitrag für dessen Wohlstand. Mehr noch: Der Mit-Unternehmer hätte ein sehr großes, weil eigenes Interesse, die Produktivität und damit seinen materiellen Wohlstand oder seinen Zeitwohlstand noch weiter zu steigern. Und bei der Auszahlung der Produktivitätsrendite könnte er zwischen zwei Währungen wählen: Zeit oder Geld. Alle würden profitieren.
Vom Mit-Arbeiter zum Mit-Unternehmer? Ja, warum denn nicht? Und der Cobot kann hier sogar der Treiber sein. Beenden wir also nicht nur die Käfighaltung der Roboter, sondern auch die Käfighaltung des Denkens.
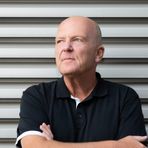
- Teradyne Robotics (Germany) GmbH
- Zielstattstraße 36
- 81379 München